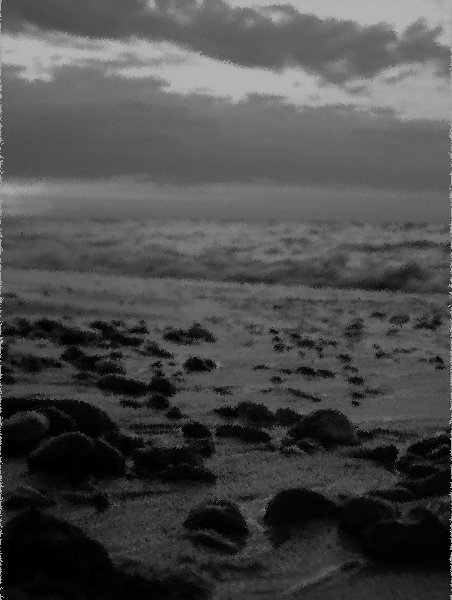Seine Hände zogen kleine, rundliche Linien durch den Sand, schienen etwas zu suchen im nassen Boden, der an einigen Stellen noch schlickige Pfützen aufwies.
Er hatte die Arme weit von sich gestreckt, den Kopf starr nach oben gerichtet, zur Sonne hin, um jeden Strahl aufzusaugen, jeden Schluck Wärme aufzunehmen. Die Ebbe war gekommen, wie sie immer kam, langsam, aber mit einer gewissen Ebenmäßigkeit, und nun saß er neben seinen Netzen, auf einem Stück Meeresboden. Die anderen Fischer lachten oft über ihn, weil er sich während jeder Ebbe hier herunter begab, statt auf der sicheren Hafenmauer oder dahinter zu stehen und seine Netze zu flicken. Er wusste, sie konnten es nicht verstehen.
Ein leises Seufzen ging über seine Lippen, und seine großen, klobbigen Füße gruben sich noch ein Stück tiefer in den Schlick, spürten die Kälte, die von unten aufstieg, ein letzter Abschiedsgruß des Meeres, dass sich zurückgezogen hatte, aber zurückkommen würde.
Oft saß er hier und tat nichts, gar nichts, lag einfach nur da und genoß die Sonne, unbeschwert, in gewisser Weise sogar fröhlich. Er saß auch hier, wenn die Sonne nicht schien, denn wenn auch die Sonne ihm keine Gesellschaft leistete, so blieb doch die Ebbe, blieb für die ihr bestimmte Zeit. Wenn sie wieder ging und mit der Flut tauschte, dann musste auch er wieder fort von diesem Ort, musste zurück, zurück in den Hafen, zurück zu seinem Schiff, zurück aufs Meer, er dachte an die tobende Gischt, die es in mancher Nacht aufwarf, an die tausend prickelnden Nadelstiche, die der Wind dort draussen auf ihn warf, ein großes wütendes Tier, dass sein Revier verteidigte, rachsüchtig, tobend, er blickte hinaus auf den weiten Schlick vor sich.
Noch herrschte Ebbe, erinnerte er sich, er sank tiefer in den kleinen Holzstuhl, den er sich mitgebracht hatte, immer mitbrachte, altes vergilbtes Holz, in seinem Aussehen seiner Haut nicht unähnlich, vom Wetter gezeichnet, aber standhaft.
Oft dachte er an das Meer und auch an seinen Beruf, der doch so untrennbar mit der See verbunden war. Er wusste, nie hätte er diesen Beruf erlernen wollen, doch seine Eltern hatten es so gewollt, und so hatte er die Schule abbrechen und seinem Vater auf dem Schiff helfen müssen. Lange war er danach auf der Flucht gewesen, heute nannte er es Flucht, sehr lange, ein einsamer, wütender junger Mann, der von Hafen zu Hafen fuhr, ohne Interessen oder Wünsche, der immer nur vor dem Meer und seinen Eltern weglief und dabei doch ebendiese See befuhr, weil er nichts anderes gelernt hatte. Viele Städte hatte er gesehen, viele Länder, viele Sprachen gehört, viele Mädchen geküsst. Doch das Meer hatte er nie hinter sich lassen können, immer hatte er es gebraucht, um weiter zu fliehen, immer hatte er es nutzen müssen, um sein Geld zu verdienen. Und das Meer hatte es ihm auf seine Weise gedankt, er dachte an unzählige Stürme, an riesige Wellen, haushohe Wände, die fließende Verwünschungen in die Nacht malten, an den grollenden Wind, der sie vorlas.
Sein Blick fiel auf die Kaimauer, eng gemauerte, riesige Steinquader, die noch neu waren und das Sonnenlicht deshalb etwas stärker widerspiegelten. Er lächelte wieder in die Sonne. In ein paar Jahren, wenn die ersten Sturmfluten gegen diese neuen Steine gedonnert waren, würden auch sie wieder vergilbt und dreckig aussehen, das Sonnenlicht nicht mehr zurückwerfen, nur noch einen matten Schein besitzen. Die anderen Männer hoch über ihm, auf der Mauer, bellten sich Befehle entgegen, und er wusste, dass die Flut bald kommen würde, und er würde wieder mit ihnen fahren. Er dachte an die drei Kinder, drei Söhne, er würde wieder für sie aufs Meer fahren, auch wenn er sie nie sehen würde.
Der alte Kutter seines Vaters war noch gut in Schuss, wie sie hier sagten, und das war gut so, denn viel brachte die Fischerei nicht mehr ein, das wussten sie alle, nur drei Fischer fuhren noch hinaus, mussten, hatten nichts anderes gelernt. Seit 22 Jahren fuhr er mit dem alten Schiff, er dachte an den Tag, an dem er sich entschieden hatte, zurückzukommen, den Tag, an dem ihn der Brief erreicht hatte, in irgendeiner der großen Hafenstädte, deren Namen er heute kaum noch wusste. Der Pfarrer hatte ihn aufgesetzt, denn seine Mutter konnte ihn nicht schreiben, war zu schwach gewesen.
Es war eine stürmische Nacht gewesen, er hatte es sich immer gut vorstellen können, war er doch hier aufgewachsen, und sein Vater war hinausgefahren, alleine, wie immer. Drei Tage später hatten sie das Boot gefunden, nur leicht beschädigt, auf der Seite liegend, in einer kleinen Bucht nicht weit von hier. Viele der Menschen hier schrieben der See einen Charakter zu, und viele hatten damals gesagt, die See hätte ihnen etwas zurückgeben wollen, als Trost, als Erinnerung. Schon damals hatte er es anders empfunden, obwohl er es nie gesagt hatte, wohl um seine Mutter zu schonen, die dennoch bald darauf gestorben war.
Da war keine Entschuldigung, kein Trost, den die See spenden wollte, nur Hohn, grenzenloser sadistischer Hohn, davon war er überzeugt. Und er dachte an das alte kleine Schiff, das er immer noch befuhr, die Botschaft war klar gewesen, es war Zynismus gewesen, mörderisch kalt wie die harten Wellen, die hier wie überall an die Küste schlugen. Er hasste das Meer dafür, und dennoch würde er bald wieder hinausfahren. Doch noch herrschte die Ebbe, noch einen kurzen Augenblick lang, seine alte Verbündete, der einzige menschliche, mitleidige Zug der See.
Nach 22 Jahren wusste er nicht mehr genau, warum er sofort zurückgekehrt war, sein weniges Erspartes für einen Flug, seinen einzigen Flug ausgegeben hatte, er wusste es wirklich nicht mehr, vielleicht war es ein Funken Übermut gewesen, den er damals noch hatte, vielleicht war es die Sorge um seine Mutter gewesen, eine alte Fischersfrau, die nie jung oder schön gewesen zu sein schien.
Als er erst einmal hier war, konnte er nicht mehr gehen, der Blick auf die See hatte ihn gebannt, und er hatte ohnehin kein Verlangen mehr nach der Welt da draußen verspürt, hatte sie gesehen und für sich seinen Frieden mit ihr gemacht. Nur seine Kinder verbanden ihn noch mit der Welt, sie lebten immer noch in großen Städten, dem Meer sehr nahe, auch wenn sie nicht viel mit der See zu tun hatten.
Und so war er hiergeblieben, überwies jeden Monat auf drei Konten, er verstand nicht viel davon, ließ das einen Freund bei der Bank im Dorf erledigen, und er fuhr zur See, jeden Tag, und manchmal kam ihm das wie ein beständiges Duell vor, ein Duell mit dem Meer, auch wenn es das nicht war, denn das Meer war ungleich stärker als er selbst. Viele der älteren -überlebenden- Fischer erzählten, dass sie immer Respekt vor dem Meer gehabt hatten, doch er wusste, das war keine Versicherung. Er begnetete dem Meer mit der selben Art von Respekt, den er den Piraten entgegengebracht hatte, die ihn früher einmal mit dem Gewehr in der Hand unter Deck gezwungen hatten, vor langer Zeit, irgendwo im Pazifik.
Doch er musste aufs Meer hinaus, konnte nicht anders. Umso glücklicher war er, dass keins seiner Kinder auf dem Meer arbeiten geschweige denn leben würde, sie alle hatten eine gute Ausbildung vor sich, er wusste das, und in gewisser Weise machte ihn das glücklicher als alles andere, auch wenn seine Kinder für ihn nur Fotos waren.
Kleine, konstant auf- und abschwingende Wellen schlossen sich um seine Füße, hatten sich unbemerkt angeschlichen und erschraken ihn nun, auf eine vertraute Weise. Die Flut kam. Er blickte ein letztes Mal in den Himmel, dann stand er auf und ging, ging zu seinem Schiff, aufs Meer. Er würde wiederkommen und wieder in der Sonne liegen, wieder und wieder und wieder. Bis es auch ihn holen würde.
„Das Meer ist salzig wie die Träne, die Träne ist salzig wie das Meer. Das Meer und die Träne sind sich durch die Einsamkeit verwandt. Das Meer hat sie schon, die Träne sucht sie.“ – Karl Gutzkow, Gutzkows Werke, Bd. 4
 25. Februar 2007
25. Februar 2007